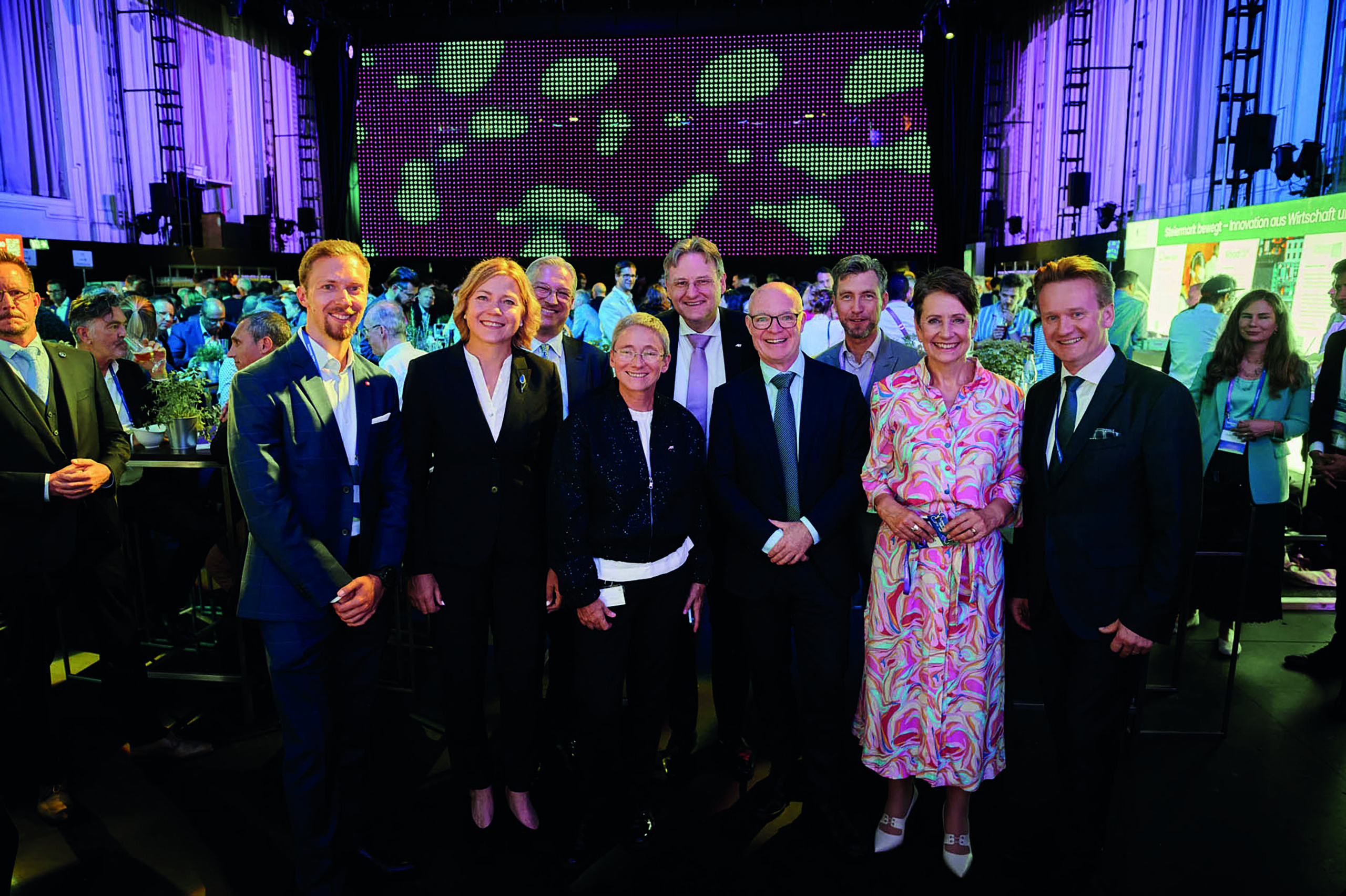Zwei Tage lang boten die Technology Talks Austria 2025 eine Plattform für die gesamte Technologie-Community des Landes. | © AIT
Zwei Tage lang boten die Technology Talks Austria 2025 eine Plattform für die gesamte Technologie-Community des Landes. Mit zwei Keynotes, sechs Plenary Sessions, 14 Workshops, sechs Side Events, zwei Formaten für junge Forschende, einer Ausstellung mit zehn Ausstellenden sowie einem großen Get-together standen insgesamt rund 35 Stunden Programm auf dem Plan.
Angeführt von EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen und Tech-Investor sowie Samsung-Spitzenmanager Young Sohn diskutierten internationale Fachleute über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Schlüsseltechnologien, Souveränität, Ressourcen und Resilienz. Ziel war es, konkrete Ansätze zu entwickeln, wie Europa seine Position im globalen Wettbewerb stärken kann.
Forschung als Schlüssel
„Die Diskussionen haben klar gezeigt, dass Forschung, Technologie und Innovation entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und Europas sind und zusätzliche Investitionen brauchen“, fasst Brigitte Bach, Sprecherin der Geschäftsführung des AIT und Vorsitzende des Veranstaltungskuratoriums, zusammen. Ebenso wichtig seien die richtigen Rahmenbedingungen, damit Forschungsergebnisse schneller in marktreife Anwendungen umgesetzt werden.
Für Andreas Kugi, Scientific Director des AIT und Vorsitzender des wissenschaftlichen Programmbeirats, sind die Talks ein unverzichtbarer Impulsgeber: „Die Technology Talks Austria 2025 sind eine zentrale Plattform für den Austausch zu Zukunftsfragen. Zwei Tage haben wir – mit wertvollem Input und Anregungen durch internationale Expert:innen – mit der gesamten österreichischen Technologie-Community diskutiert, jetzt gilt es zu handeln.“
Die Diskussionen mündeten in eine Reihe von Kernaussagen, die aufzeigen, wie Europa seine Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit stärken kann:
Zentrale Botschaften aus den Debatten:
Künstliche Intelligenz kann ein Produktivitätstreiber werden – vorausgesetzt, Technologie, Kreativität und soziale Verantwortung greifen ineinander.
• Europa muss stärker in eigene digitale Technologien investieren, um Abhängigkeiten von den USA und China zu verringern.
• Technologieführerschaft erfordert gemeinsame Strategien, Bündelung von Stärken und verstärkte Public-Private Partnerships.
• Resilienz entsteht durch Recycling, Kreislaufwirtschaft, effiziente Ressourcennutzung und robuste Lieferketten – dies erfordert Investitionen in Forschung und Infrastruktur.
• Zusätzlich zu höheren Investitionen in Forschung und Innovation braucht es bessere Rahmenbedingungen: Notwendig sind klare Fokussierung, schnellere Entscheidungen, weniger Regulierung, ein gestärkter Binnenmarkt sowie eine gezielte Förderung von Talenten.
• Europa muss nicht nur besser, sondern schneller besser werden als die Konkurrenz.
• Für erfolgreiches Scaling-up ist ein funktionierender europäischer Risikokapitalmarkt unverzichtbar.
• Forschung, Innovation, Bildung und Industrie sollten eng verzahnt sein. Das nächste europäische Forschungsrahmenprogramm FP 10 muss mit dem EU Competitiveness Fund sowie der Industriepolitik abgestimmt sein.
• Österreichs FTI-System muss strukturell weiterentwickelt werden – ein „Weiter wie bisher“ reicht nicht.
• Kohärenz ist entscheidend: FTI-Pakt, Universitätsbudgets, Steueranreize und EU-Programme müssen ineinandergreifen, um Innovationskraft freizusetzen.
• Europa verfügt über exzellente Wissenschaftler:innen, starke Bildungsstrukturen, einen reichhaltigen Talentpool und eine solide industrielle Basis – darauf gilt es aufzubauen.