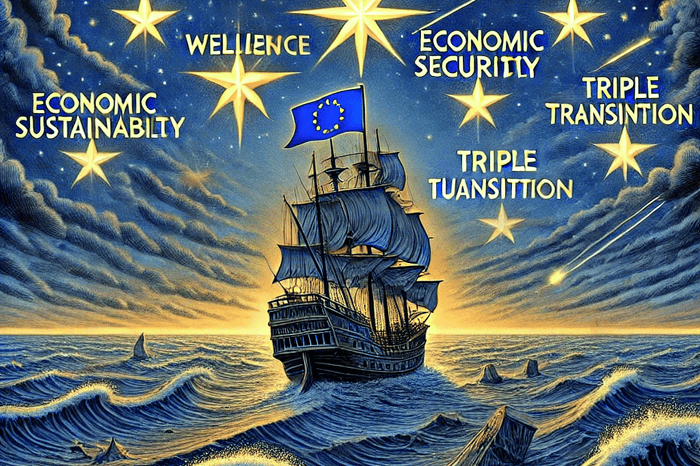Beschlossen, das kann man sagen, ist noch nichts. Noch diskutiert die Europäische Union, jetzt nach den EU-Wahlen, über ihre künftige Ausrichtung. Ursula van der Leyen wurde zwar wieder zur Kommissionspräsidentin gewählt. Ihr Team aus Kommissären, zu dem auch der derzeitige (Noch-)Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) als Migrationskommissar zählen wird, ist aber noch nicht im Amt (Stand mit Redaktionsschluss Ende September). Traditionell gilt der November als frühester Termin, bei dem das neue Kommissionsteam vom Europäischen Parlament abgesegnet wird. Bis dahin aber wird noch gestritten – um Posten, Themen und Visionen.
Wie und in welchem Zustand dabei der bisherige Nordstern der EU, der „Green Deal“, überleben wird, das ist noch keine ausgemachte Sache. Dazu hat auch der neue Report von Mario Draghi beigetragen. Im Auftrag der Europäischen Kommission hat der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB; 2011 bis 2019) und Premierminister Italiens (2021 bis 2022) im Dezember 2022 den offiziellen Auftrag bekommen, einen umfassenden Bericht über die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu verfassen.
Draghi-Report – treffend oder zu düster?
Anfang September hat Draghi seinen Bericht vorgestellt: Der erfahrene Wirtschaftsökonom, der es verstand, Europa durch tiefe Krisen zu leiten, hat einen eher düsteren Bericht abgeliefert. Draghi in a nutshell: Europa ist im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig. Es braucht hunderte Millionen Euro, und zwar jährlich, um den Karren wieder flott zu machen. Das sei nun aber zu düster, meinen einige. Nein, nein, sehr treffend, meinen wieder andere.
Wie auch immer: Der „Green Deal“ der EU wird für das Fiasko von Draghi dabei nicht als Ursache genannt oder in Zweifel gezogen. Eher wird verwundert die Frage gestellt, warum keine Umsetzung in flotte Geschäftsmodelle erfolgte. Man habe zwar alle notwendigen Maßnahmen für eine Energiewende getroffen. Das aber habe sich weder in niedrigeren Energiepreisen noch in einer gar verbesserten Wettbewerbsfähigkeit Europas niederschlagen. Im Gegenteil: Vergleicht man die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU mit dem der USA und China über den Zeitraum der letzten 20 Jahre, so zeige sich, dass Europa immer stärker abgehängt werde. Wohl wuchs das europäische BIP von 2000 bis 2022 um 35 Prozent. Die USA konnten aber im selben Zeitraum ein Wachstum von fast 60 Prozent verzeichnen. Und Chinas Wirtschaftsleistung hat sich in den letzten 20 Jahren mit 520 Prozent mehr als verfünffacht – und liegt nun auch in absoluten BIP-Zahlen vor der Europäischen Union.
China als strategische Bedrohung
Vor allem Chinas Aufstieg zur internationalen Wirtschaftsmacht bereitet mittlerweile nicht nur Draghi Sorgen. Ging man um die Jahrtausendwende noch davon aus, mit dem aufstrebenden China neue Absatzmärkte erschließen zu können und später in der sich entwickelnden Wirtschaft des Landes neue Partner zu finden, so wird China heute als strategische Bedrohung angesehen.
Das kommt auch nicht von ungefähr: China fährt seit Jahren erfolgreich eine hochkompetitive und aggressive Wachstumsstrategie, was sich nicht nur im BIP und in den Exportzahlen niederschlägt. Mittlerweile ist das Reich der Mitte in den Schlüsselmärkten für die europäische Energiewende Weltmarktführer – bei Photovoltaik-Modulen, bei der Windkraft, bei E-Auto-Batterien und in der Elektromobilität selbst. Aus europäischer Perspektive eine Katastrophe, denn gerade mit Green Deal und Energiewende hätte sich Europa aus internationalen (Energie-)Abhängigkeiten befreien sollen.

Protektionismus – die Lösung?
Um die neue Marktmacht Chinas zu beschränken, wird mittlerweile in den USA und Europa zu protektionistischen Maßnahmen gegriffen, etwa zu Strafzöllen auf Importen aus China wie bei Elektroautos. Erst die massive Subventionierung durch den Staat ermögliche es chinesischen Unternehmen, derart billig zu produzieren, heißt es in den Begründungen für die Schutzzölle. Das stimmt allerdings nur teilweise. Chinas Elektroautoindustrie setzt etwa auf Kleinwagen, was Elektromobilität weit günstiger macht und die Nachfrage potenziell steigert. Zudem hat es ein Ökosystem für die E-Autoindustrie entwickeln können, durch das die Entwicklungszeit für neue Modelle von fünf bis sieben Jahren auf zwei bis drei Jahre reduziert werden konnte.
Gerade das aber mache der europäischen Autoindustrie zu schaffen, die bei Elektroautos bis jetzt mehr auf eine Hochpreispolitik mit langen Entwicklungszeiten setzte. Auf lange Sicht wird man sich bei europäischen und deutschen Autobauern allerding neue Strategien überlegen müssen, die auch ohne Protektionismus funktionieren, sagen Wirtschaftsstrategen. Ansonsten könnte es VW, BMW & Co. so ergehen wie Nokia, nachdem Apple 2007 das iPhone eingeführt hatte, warnt der deutsche Experte für Automotive Management, Stefan Bratzel. Der finnische Weltmarktführer für Handys verschwand vom Handymarkt, weil er die Umstellung auf Touchscreen-Technologie nicht geschafft hatte.
„Wir müssen vieles gleichzeitig in Angriff nehmen. Lineares Denken wird das nicht bewerkstelligen.“ – Andrea Renda, Forschungsdirektor vom Centre for European Policy Studies bei den Technology Talks Austria by AIT in Wien.
Triple statt green transition
Fest steht daher eines: Den Green Deal, so wie er vor fünf Jahren verabschiedet wurde, wird es in dieser Reinform bald nicht mehr geben. Heute ist nicht nur mehr von einer „green transition“ die Rede, sondern von einer „twin transition“ oder „triple transition“, mit der Europa verlorenes Terrain im internationalen Wettbewerb in Digitalisierung und Industrie zurückerobern solle. „Wir müssen vieles gleichzeitig in Angriff nehmen“, sagt Andrea Renda, Forschungsdirektor vom Centre for European Policy Studies bei den Technology Talks by AIT in Wien. „Lineares Denken wird das nicht bewerkstelligen“, so Renda.
Den „Nordstern Green Deal und Klimaneutralität“ wolle man dabei aber nicht verräumen, erklärt der EU-Stratege. Denn es sei von Haus aus schon unklug, alle paar Jahre seine strategischen Ziele über den Haufen zu werfen. So gut wie alle Industriesektoren, auch so energieintensive wie die Stahl- oder Zementindustrie, haben mittlerweile Strategien entwickelt, mit denen sie ihre Produktion bis spätestens 2050 klimaneutral bewerkstelligen können. Jetzt gehe es darum, dies auch als Wettbewerbsvorteil auf den Boden zu bringen. Ob Österreich dabei seine ambitionierten Ziele für die Klimaneutralität bereits, so wie angedacht, bis 2040 schafft oder ein paar Jahre später (2043 oder 2044), sei in diesem Zusammenhang eher egal, meinen einige Stimmen. Hauptsache, die Wettbewerbsfähigkeit komme in Schwung.
Effizienzsteigerungen durch Dekarbonisierung
Da der Green Deal ohnehin nie als selbstlose Klimarettungsaktion angelegt war, sondern zumindest auch als strategische Entscheidung für nachhaltiges und das heißt sparsames und innovatives (Energie-)Wirtschaften, stehen die Chancen gut, dass die neue Wettbewerbsstrategie aber auf der alten Green-Deal-Vision aufbauen wird. Oder anders gesagt: Wer rechnen kann, setzt ohnehin von Haus aus auf die klimaneutrale Energiewende. Denn mittelfristig bringt die Dekarbonisierung aller gesellschaftlichen Sektoren, vom Heizen bis zur Stromerzeugung, nicht nur Klimaziele, sondern auch gewaltige Effizienzsteigerungen.
Ein Beispiel: Wer mit einer Wärmepumpe Prozesswärme für indus-trielle Anlagen erzeugt oder Wohnhäuser heizt, kann bis zu drei Viertel der dafür benötigten Energie kostenlos der Umgebung entnehmen. Wärmepumpen, deren Basistechnologie schon fast 200 Jahre als ist, konnten sich in vielen industriellen Anlagen nur deshalb so lange nicht durchsetzen, weil fossile Energie spottbillig war. Jetzt ist die Situation anders. Strategisch betrachtet wird die Wette auf fossile Energie zunehmend unattraktiver, da sie die Produktion durch Beschaffungs-krisen – nicht zuletzt durch die russische Ukraine-Invasion – wesentlich verteuern kann.
Oder Beispiel Elektromobilität: Wer mit einem Elektromotor im Auto fährt, ist Verbrennermotoren in effizienter Energieausbeute haushoch überlegen. Elektroautos bringen mindestens 80 Prozent der Batterieenergie auf die Straße und nicht nur 25 bis 30 Prozent der Energie aus Benzin und Diesel wie Verbrennermotoren. Österreichs Strommix mit 80 Prozent erneuerbarer Energie macht Elektromobilität zudem bereits auf den ersten Kilometern grün. Wer eine PV-Anlage am eigenen Hausdach hat (plus Speicher in der Garage) kann zudem selbst erzeugte Solarenergie kostenlos während der Nacht ins eigene Auto tanken. Wahrscheinlich ist der Green Deal schon deshalb in vielen Bereichen und Köpfen zu einem Selbstläufer geworden, der auch durch Diskussionen über „Technologieoffenheit“ in der Automobilproduktion im „Autoland Österreich“ nicht mehr zu stoppen ist.
„Industrie 5.0“ durch Innovation
In anderen Worten: Europa wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin die Ziele des Green Deals verfolgen, aber durch Digitalisierung und die Weiterentwicklung von „Industrie 4.0“ zu „Industrie 5.0“ gleichzeitig auch die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union wieder in die Gänge bringen wollen. Dafür sollen viele neue europäische Ini-tiativen und Forschungsprojekte den Weg ebnen. Im Idealfall sollte europäische Forschung und Entwicklung etwa innovative alternative Technologien entwickeln, die mit Rohstoffen funktionieren, bei denen man nicht mehr auf China angewiesen ist. Damit könnte man Dependenzen von China in Schlüsseltechnologien elegant umgehen, indem man eben selbst neue entwickelt. Innovation gilt derzeit jedenfalls als größtes Stärkepotenzial in der Europäischen Union. Darauf schwören Draghi und so gut wie alle anderen Wirtschafts- und Forschungsexperten.
Allerdings purzeln disruptive Innovationen auch nicht so planbar aus der Pipeline, wie sich das mancher Stratege gerne wünschen würde. Jedenfalls braucht es dafür frisches Geld. Und zwar gleich viel davon. Ob und in welchem Ausmaß dabei ein gemeinsames Schuldenmachen der EU, so wie von Mario Draghi vorgeschlagen, zur Anwendung kommen wird, ist freilich noch alles andere als ausgemacht. Draghis Idee, Europa mit einer Art „Marshallplan“ von fast 800 Milliarden Euro jährlich wieder flott zu machen, gilt als eher unwahrscheinlich. Denn für eine gemeinsame Finanzierung des Fortschritts auf Pump bedarf es einer einstimmigen Zustimmung aller EU-Länder im europäischen Rat. Die wird es aber so kaum geben. Deutschland, die Niederlande, aber auch Schweden, Dänemark und Österreich, die als die europäischen Sparefrohs gelten, stehen einer Vergemeinschaftung der Schulden sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber.
Worauf sich aber alle recht schnell einigen könnten, wäre, das Forschungsbudget von derzeit 100 auf 200 Milliarden Euro zu verdoppeln. Diese Draghi-Forderung findet breite Unterstützung, auch von der Industrie. Die Begründung ist einleuchtend: Es dürfe nicht der Fehler gemacht werden, in Zeiten der Krisen und schwächelnder Konjunktur bei Forschung und Entwicklung zu sparen oder, wie es Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, formuliert: „F&E-Ausgaben sind Zukunftsausgaben. Die Kuh, die wir morgen melken wollen, sollten wir heute sehr gut füttern.“
Lesen Sie diesen Artikel ab Seite 35 der aktuellen Ausgabe 5-24 im Austria Kiosk!