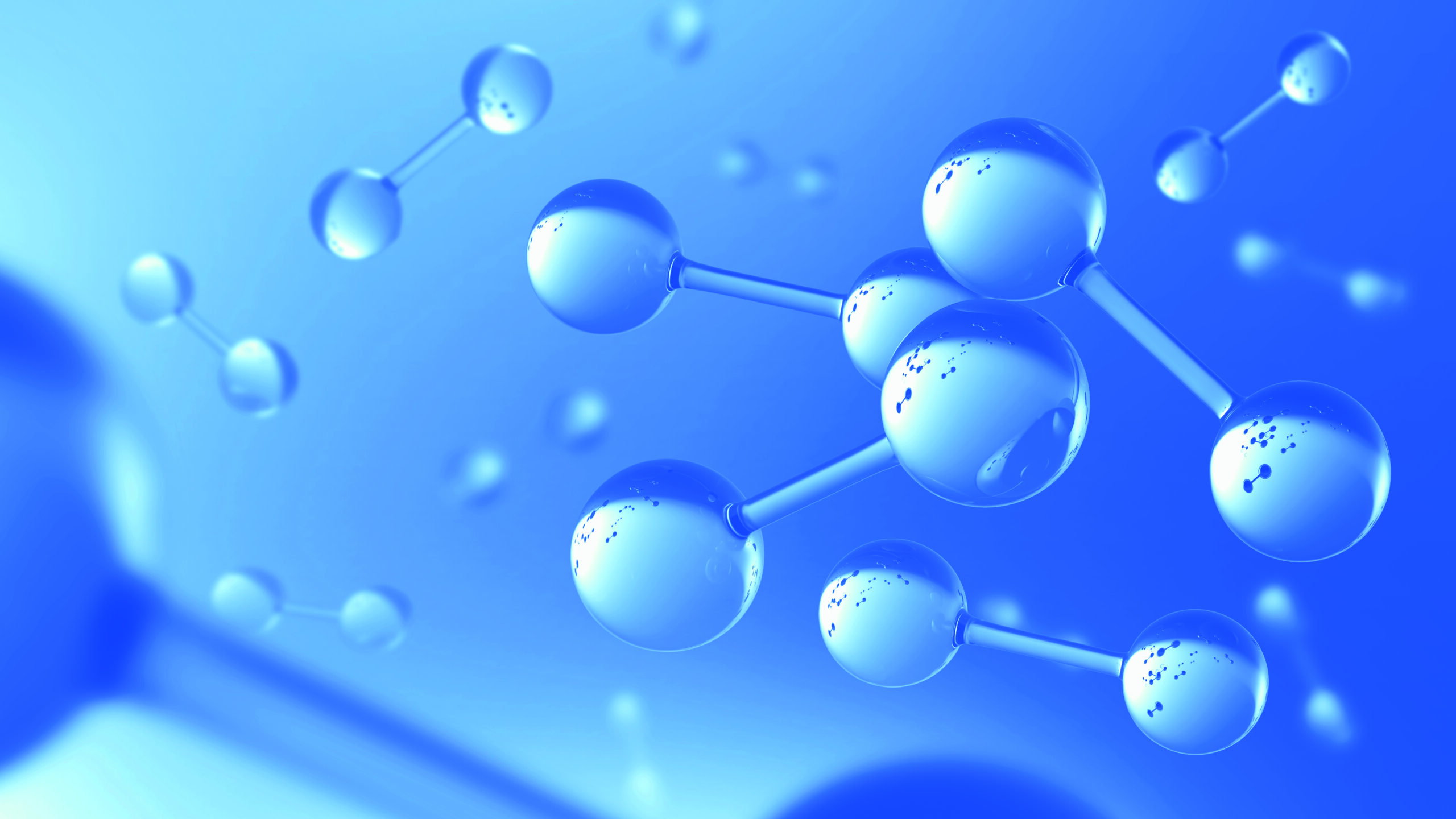© Shutterstock
Manche Erinnerungen aus dem Schulunterricht verblassen nie. Zum Beispiel die Herstellung von Wasserstoff: Am Tisch des Vortragenden steht ein Glasbehälter mit Wasser, in das zwei mit einer Batterie verbundene Elektroden getaucht werden. Es blubbert, Blasen steigen auf, die gesammelt und angezündet werden. Das Resultat: ein lauter Knall, der selbst den unaufmerksamsten Schüler aus seinen Träumen schreckt.
Heute ist die Herstellung von H2 – so die chemische Formel – mit Hilfe von Strom aus Wasser ein Schlüsselthema der Energiewende. Die Technologie ermöglicht es, Wind- und Solarstrom in ein Gas umzuwandeln, das sich flexibel speichern und transportieren lässt, das in der Industrie, aber auch in Teilbereichen der Mobilität fossile Energieträger ersetzen könnte und dabei nur null bis fünf Prozent der CO2-Emissionen von Erdgas verursacht.
Rechtliche und technische Hürden
Diese vielversprechenden Eigenschaften haben den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz im Jahr 2020 zu einem vollmundigen Statement veranlasst. Bei einem Besuch bei Magna in Steyr versprach er sinngemäß, dass Österreich die Wasserstoff-Nation Nummer 1 werden und ihr Know-how exportieren solle. Heute ist diese euphorische Ankündigung manchen Branchenvertretern eher peinlich. Vom Weg zur Wasserstoff-Nation Nummer 1 ist keine Rede mehr, manche meinen sogar, Österreich liege im Vergleich zu den meisten anderen EU-Ländern eher im unteren Mittelfeld.
Doch das Bild ist differenzierter: Der Weg zur Wasserstoff-Zukunft ist steiniger als zunächst gedacht. Der Aufbau der Infrastruktur und die industrielle Nutzung des neuen Energieträgers sind mit zahlreichen rechtlichen und technischen Hürden verbunden. An deren Lösung wird abseits der Öffentlichkeit gearbeitet –wobei angesichts der aktuellen Baustellen der Regierung das Tempo oftmals zu wünschen übriglässt.
Paukenschläge auf dem Weg zur H2-Nutzung
Aber im letzten Monat gab es einige Paukenschläge auf dem Weg zur H2-Nutzung. Am 16. September präsentierten Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Wolfgang Anzengruber, Vorsitzender des HyPA-Beirats, einen Fahrplan für die Wasserstoff-Zukunft. Österreich will nun nicht mehr die Nummer 1 werden, aber immerhin eine europäische Drehscheibe für grünen Wasserstoff. Kern der Offensive ist der Aufbau einer Wasserstoff-Importstrategie, neue Förderungen für Elektrolyseanlagen sowie die Entwicklung von Speicher- und Leitungsinfrastruktur.
Konkret kündigte Hattmannsdorfer an, dass die Wasserstoffzertifizierungs-Verordnung (WstVO), eine Umsetzung von EU-Vorgaben, noch heuer in Kraft treten soll. Sie wird mehr Rechtssicherheit schaffen, in vielen Fällen erst die Vergabe von Fördermitteln ermöglichen und trägt damit wesentlich zur Investitionssicherheit bei. Eine Verordnung, die erstmals Investitionszuschüsse für Elektrolyseanlagen vorsieht, soll ebenfalls noch heuer in Kraft treten.
Hy4Smelt: erste industrielle Demonstrationsanlage
Neun Tage später, am 25. September griffen bei einem symbolträchtigen Spatenstich in Linz gezählte 20 Prominente aus Wirtschaft und Politik für das Projekt Hy4Smelt zur Schaufel. Hy4Smelt ist die weltweit erste industrielle Demonstrationsanlage, die auf dem Weg zur Net-Zero-CO2- Stahlproduktion zwei innovative Prozesse – eine wasserstoffbasierte Direktreduktion für ultrafeine Eisenerze und einen elektrischen Schmelzprozess – verbinden soll.
Bauherr voestalpine bezeichnet Hy4Smelt als Österreichs größtes Klimaschutz-Forschungsprojekt. Neben dem heimischen Stahlerzeuger gehören der internationale Anlagenbauer Primetals Technologies und Rio Tinto, einer der global größten Bergbaukonzerne, zum Konsortium des Projektes. Co-Investor ist das Handels- und Investmentunternehmen Mitsubishi Corporation.
Größte Elektrolyseanlage Europas
Am 29. September gab es abermals einen großen Spatenstich für ein H2-Projekt: In Bruck an der Leitha startete der Bau einer der größten Elektrolyseanlagen Europas für grünen Wasserstoff. Errichtet wird die 140 MW Anlage um einen dreistelligen Millionenbetrag von OMV in einem Konsortium mit Siemens Energy und STRABAG. Schon Ende 2027 soll sie jährlich mit erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraft 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren.
Der umweltfreundliche Energieträger wird dann über eine rund 22 Kilometer lange Wasserstoffpipeline in die Raffinerie Schwechat transportiert und dort für die Produktion von Kraftstoffen- und Chemieprodukten eingesetzt. Die OMV erwartet durch die H2-Nutzung eine Verringerung der CO2-Emissionen von bis zu 150.000 Tonnen pro Jahr, etwa zehn Prozent der derzeitigen direkten, produktionsbedingten Emissionen der Raffinerie. Am Gelände der Raffinerie in Schwechat betreibt die OMV bereits eine UpHy Plant, die größte betriebsbereite Elektrolyseanlage des Landes mit einer Leistung von 10 MW und einer jährlichen Kapazität von 1.500 Tonnen grünem Wasserstoff.
Nicht immer wirtschaftlich
Im September gab es allerdings nicht nur diese drei erfreulichen Ereignisse, sondern auch einen herben Rückschlag: Das gemeinsame Projekt „Green Ammonia Linz – GrAmLi“ von LAT Nitrogen und Verbund zur großtechnischen Produktion von grünem Wasserstoff wurde abgesagt. Die Anlage mit einer Leistung von 60 MW sollte H2 zur Herstellung von Düngemitteln, Melamin und technischen Stickstoffprodukten liefern. Die Absage erfolgte wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit.
Dass die Wirtschaftlichkeit von H2- Projekten derzeit nicht immer gegeben ist, bestätigt auch Andreas Indinger von der Österreichischen Energieagentur (AEA): „Der Herstellungskosten und damit der Preis für grünen Wasserstoff sind eine der großen Herausforderungen der Dekarbonisierung“, meint er. Die AEA fungiert als Managementstelle für die Hydrogen Partnership Austria (HyPA), die Österreichs Kräfte zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie bündeln soll.
Vorteile von Wasserstoff
Derzeit liegt der Großhandelspreis für Wasserstoff bei etwa 150 Euro pro Megawattstunde, für Erdgas bei rund 35 Euro. Der direkte Vergleich greift jedoch zu kurz, meint Indinger. Er betont, dass grüner Wasserstoff vermutlich nie so billig sein werde wie Erdgas in früheren Zeiten. „Aber es müssen auch andere Punkte, vor allem die völlig unterschiedlichen Emissionswerte der Energieträger inklusive deren Herstellung berücksichtigt werden.“ Dazu kommen weitere Vorteile von Wasserstoff wie etwa überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen quasi speicherbar zu machen.
Dennoch seien marktgerechte Preise für grünen Wasserstoff wesentlich, um der Technologie zum Durchbruch zu verhelfen, argumentiert Michael Mock, Geschäftsführer der Österreichischen Vereinigung für das Gas-und Wasserfach (ÖVGW): „Sollen die Klimaziele Realität werden, müssen wir Wasserstoff kostengünstig anbieten, insbesondere um die energieintensive Industrie im Land zu halten.“ Besonders Österreichs wichtige Industriezweige wie Papier, Stahl, Chemie und Glas seien im Zuge der Dekarbonisierung auf grünen Wasserstoff angewiesen. „Und wir brauchen große Mengen davon“, unterstreicht Mock.
Um ganz Österreich ausreichend mit kostengünstigem H2 zu versorgen, muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Es sind bessere Bedingungen für den Ausbau der inländischen Wasserstoff-Produktion sowie der Verteilnetze erforderlich. Außerdem müssen – da die inländischen Kapazitäten nicht ausreichen werden – länderübergreifende Pipelinesysteme für den H2-Import aus-bzw. umgebaut und Verträge mit künftigen wichtigen Produktionsländern abgeschlossen werden. Tunesien, Marokko und nach Beendigung des Krieges auch die Ukraine und andere Länder im Osten könnten künftig H2 kosteneffizient und in großen Mengen liefern.
Essentiell: die Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG)
Ein zentraler Hebel für Investitionen in Elektrolyseur-Anlagen, in Verteilnetze und auch in erforderliche Umbauten bei den Abnehmern ist die Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG). Indinger meint, dass die neue Fassung deutlich mehr Sicherheit für Investoren bringen werde. „An den Fördergeldern allein scheitert es nämlich schon bisher nicht,“ sagt er. Mitte des kommenden Jahres soll das novellierte GWG vorliegen.
Auf die Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG) und dessen Anpassung an die neuen Anforderungen der Energiewende und der Wasserstoffstrategie wartet auch Dominik Matheisl, Wasserstoffbeauftragter der Linz AG. „Die nationale Umsetzung des Gas-/Wasserstoff-Binnenmarktpakets durch das neue GWG schafft den verlässlichen Rechtsrahmen und damit die Basis für Planungs- und Investitionsentscheidungen von Netzbetreibern, Versorgern und Industrie gleichermaßen.“
Gesamte Wertschöpfungskette
Die Linz AG, Energieversorgerin im Zentralraum Linz und Teilen Oberösterreichs mit eigenen Kraftwerksparks, betrachtet Wasserstoff als Bindeglied zwischen Strom, Wärme und Industrie. „Wir entwickeln H2 als Systemlösung entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Speicherbarkeit von grüner Überschussenergie im Sommer, Spitzenlastabdeckung für Strom und Fernwärme im Winter sowie die Versorgung industrieller Abnehmer mit einem dekarbonisierten, gasförmigen Energieträger“, berichtet Matheisl.
Das Unternehmen will H2 aus erneuerbarem Strom erzeugen und Nebenprodukte wie Sauerstoff und Abwärme sinnvoll zu nutzen. Der Wasserstoff soll über ein schrittweise wachsendes Startnetz in Linz und im Zentralraum verteilt werden. „Ziel ist es, Erzeuger und erste Abnehmer in Linz versorgungssicher und bedarfsgerecht an die Speicher der RAG in Oberösterreich und an das entstehende, vorgelagerte Netz anzubinden“, sagt Matheisl.
Ebenso wichtig wie der Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur im Inland ist der Aus- und Umbau länderübergreifender Pipelinesysteme für den H2-Import. Ein Schlüsselprojekt ist der SoutH2-Korridor, dessen österreichischer Abschnitt von Arnoldstein an der italienischen Grenze nach Baumgarten und weiter über Oberkappel (OÖ) nach Deutschland führt. Über Italien könnte diese Pipeline über großteils bestehende Leitungen Wasserstoff aus Nordafrika für Österreich importieren und große Mengen auch nach Deutschland weiter liefern. „Entscheidungen sollten hier mutig getroffen werden, denn wir als Gas Connect Austria sind sehr interessiert, die Transitaufgaben, die Österreich bislang im Erdgasnetz ausführte, auch bei Wasserstoff aufrecht zu erhalten“, sagt Armin Teichert, Unternehmenssprecher der Gas Connect Austria.
Österreich soll rasch wasserstoff-fit werden
ÖVGW-Geschäftsführer Mock fordert ebenfalls, dass die großen Hochdruckleitungen durch Österreich rasch wasserstoff-fit gemacht werden: „Wenn wir uns zu lange Zeit lassen, werden die Wasserstoffströme um Österreich herum verlaufen, dann hätten wir unsere Rolle als Gasdrehscheibe in Europa verloren und müssten auch Nachteile beim Wirtschaftsstandort und bei der Versorgungssicherheit in Kauf nehmen“, warnt Mock.
Die Investitionen in die Wasserstoff-Leitungsnetze werden auf rund 3,5 Milliarden Euro geschätzt – fast ein Klacks im Vergleich zum klimafreundlichen Umbau des Stromnetzes mit 13 Milliarden Euro. Um die Finanzierung zu erleichtern, haben sich Anfang Oktober die Fernleitungsnetzbetreiber Gas Connect Austria GmbH (GCA) und TAG GmbH (TAG) eine „budgetfreundliche“ Lösung einfallen lassen: Ein über eine Staatsgarantie abgesichertes H2-Hochlaufkonto. Es würde, so die Initiatoren, eine Grundlage für rasche Investitionen schaffen, Risiken ausgewogen verteilen und von Beginn an marktverträgliche Transporttarife für Wasserstoffkunden schaffen.
Im Dornröschenschlaf ist Österreichs Wasserstoff-Zukunft also nicht. Andreas Indinger von der Österreichischen Energieagentur fasst die derzeitige Situation treffend zusammen: „Der Zug ist auf Schiene, er muss aber noch losfahren und dann sind noch ein paar Weichen zu stellen.“ Kräftig Tempo aufnehmen sollte der Zug auch noch, könnte man hinzufügen.
Von der Elektrolyse bis zur LKW-Brennstoffzelle: In Graz befindet sich eine führende H2-Forschungseinrichtung.
Nicht nur bei den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ist für Österreichs Wasserstoffzukunft noch viel zu tun. Auch die Technik muss noch weiter entwickelt werden. Die HyCentA Research GmbH in Graz ist hier mit 120 Mitarbeitern aktiv. „Wir forschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wasserstoff“, erzählt Ewald Wahlmüller. Das Institut sieht sich als eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen für Wasserstofftechnologien und elektrochemische Systeme.
Es gibt vier Forschungsschwerpunkte berichtet Wahlmüller: Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff mittels Elektrolyse und Power-to-X, innovative Speichertechnologien und Brennstoffzellen für den Energie- und Industriesektor, nachhaltige Antriebslösungen für die Mobilität mit neuen Brennstoffzellen-und Speichersystemen sowie die Kreislaufwirtschaft von Wasserstofftechnologien und Systemoptimierung für den Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff.
Bei der H2-Produktion gibt es einen starken Fokus auf die AEM-Elektrolyse. „Sie benötigt weniger Edelmetalle als die klassische PEM-Technologie und verspricht dadurch ein hohes Kostensenkungspotential“, sagt Wahlmüller. Bei HyCentA wird beispielsweise an der Verbesserung der Haltbarkeit der Komponenten für die AEM-Technologie gearbeitet, die derzeit noch hinter den Wettbewerbstechnologienliegt.
Viele Forschungsarbeiten werden gemeinsam mit der Wirtschaft durchgeführt. So ist die HyCentA etwa in das das Projekt „Renewable Gasfield“ in der Gemeinde Gabersdorf involviert. Bei diesem aus Mitteln des Klima- und Energiefonds geförderten Projekt wird eine an eine Methanisierungsanlage gekoppelte Wasserstoffproduktion gebaut, die jährlich rund 300 Tonnen H2 produzieren soll. Auch das UpHy Projekt der OMV, die Elektrolyseanlage von Linde in Villach, die seit August grünen Wasserstoff für die gesamte Halbleiterfertigung von Infineon liefert oder das Projekt DeCarb, für das die Kelag ab 2026 in Villach eine Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff zur Versorgung von 35 Bussen errichtet, wird von HyCentA forschungsmäßig begleitet.